Gliederung:
- Begrüßung
- Johann Friedrich Reichardt
- Hintergrund zu den Liedern/Gedichten der 1. Gruppe
- 1. Gruppe
- Franz Schubert/Goethe
- Hintergrund zu den Liedern/Gedichten der 2. Gruppe
- 2. Gruppe
-PAUSE-

Script zu Goethe-Gesprächskonzert
im Stadttheater Hildesheim, 24.2.99
1.Gruppe:
Johann Friedrich Reichardt:
|
Franz Schubert: Schubert ist mit Sicherheit einer der kongenialsten Vertoner von Goethes Lyrik. Zeit seines Lebens hat er versucht, die Anerkennung dieses großen Dichters zu erlangen, was ihm leider versagt blieb. Zweimal hat Schubert Goethe einige seiner Lieder zugeschickt. Beim ersten Mal 1816, begleitete ein Brief seines Freundes Spaun die Sendung, der vielleicht dazu geführt haben mag, dass Goethes derzeitiger Sekretär und musikalischer Berater, Zelter, die Kompositionen Schuberts sofort dem Papierkorb übergab. Goethe hat die Vertonungen vom Erlkönig, Gretchen am Spinnrad, der Hirtenklage und von Meeres Stille wahrscheinlich nie erhalten oder, zu dem Zeitpunkt, nie zu Gesicht bekommen. Auch bei der zweiten Sendung, 1825, als ihm Felix Mendelssohn neben seinem eigenen Streichquartett die Noten von An Schwager Kronos, An Mignon und Ganymed zukommen ließ, bedankte sich Goethe zwar für das Streichquartett, über die Lieder jedoch hüllte er sich in Schweigen. Erst 1830, nachdem ihm Wilhelmine Schröder-Devrient den Erlkönig vorgesungen hatte, den Schubert ihm bei der ersten Lieferung widmen wollte, war er ganz hingerissen vor Bewunderung und erkannte den Irrtum von damals. Ein Grund für seine damalige Abneigung gegen Schubert, war, neben einer Favorisierung der Tonsprache Mozarts, die Abneigung gegen die Romantik überhaupt, die er als krankhaft ansah in ihrer Grenzausweitung und in ihrem Streben nach Unendlichkeit. Das lehnte er, ganz Klassiker, ab und verschrieb sich den „wahren“, „vernünftigen“ Grenzen. Zur 2.Gruppe: Um Grenzen, beziehungsweise um deren Auflösung, geht es auch in den Eckstücken unserer Schubert-Gruppe. Da haben wir zunächst Ganymed, den Gegenpart zu Prometheus. Wo Prometheus sich von den Göttern lossagt, sich von ihnen „emanzipiert“, strebt Ganymed ihnen entgegen, um letztlich mit der Schöpfung zu verschmelzen. Dem aktiven Prometheus der „alles selbst“ geschaffen hat, steht der passive Ganymed gegenüber, der sich „umfangend, umfangen“ zum „allliebenden Vater“ emportragen lässt. In den Grenzen der Menschheit, zeigt sich eben genau die Absage des - inzwischen gereiften - Klassikers an die Grenzenlosigkeit, die ich vorhin angesprochen habe. In ihr stellt sich auch eine weitere Gegenposition zum Prometheus dar („Denn mit Göttern soll sich nicht messen irgendein Mensch“). „Menschheit“ ist übrigens wie „Menschsein“, oder „menschliches Wesen“ zu verstehen, so wie im Faust. („Der Menschheit ganzer Jammer fasst mich an“/Kerkerszene) Die beiden Lieder der Suleika, aus dem West-östlichen Divan, einer Nachdichtung aus dem Persischen, passen eigentlich gar nicht in den heutigen Rahmen, da sie nämlich gar nicht von Goethe selbst sind, sondern von Marianne von Willemer. Goethe hat diese Gedichte, leicht bearbeitet, in seine Gedichtsammlung aufgenommen, so dass man sie heutzutage als Goethesche Dichtung betrachtet. Mit diesem Irrtum aufzuräumen, ist eigentlich schon Anlass genug, um diese Lieder aufzuführen, zumal sie wirkliche Perlen in Schuberts Werk darstellen. Wanderers Nachtlied ist auf Goethes Harzreise im Jahre 1776 entstanden und erschien im Druck immer im Zusammenhang mit dem korrespondierenden Lied: „Über allen Gipfeln ist Ruh“. Es ist, ob seiner Kürze, für viele Komponisten eine Herausforderung gewesen und Schuberts Version ist sicher eine der gelungensten |
2. Gruppe:
Franz Schubert:
- PAUSE -

|
Goethe erwartete von der Musik vor allem „Beruhigung“, „geistigen Nutzen“ und „Inspiration“. Oft bekannte er, dass er besser arbeiten konnte, nachdem er Musik gehört hatte. Zu diesem Zwecke ließ er sich dann ein paar Musiker ins Haus kommen, die dann für ihn aufspielten. Zur Musik der Romantik, aber auch schon zur Musik Beethovens hatte er keinen Zugang und so ließ er weder Schubert, noch Beethoven, noch Weber gelten. Er verabscheute das Laute und das Pathetische, das den Komponisten der Romantik im Vergleich zur Klassik eigen war. Über die Instrumentierung von Spontinis "Vestalin" äußerte er sich einmal, dass er sie „berauschend“ fände, dass es jedoch eine „Grenze“ geben müsse, die „nicht überschritten werden kann, ohne dass das Ohr sich widersetzt“. Da Goethe einen Schubert und einen Beethoven verkannte, schloss die Nachwelt daraus, dass er eigentlich gar nichts von Musik verstand. Das trifft jedoch nicht zu. Als Kenner des Gesanges, des Klavier- und Violoncellospiels erwies er sich im Besitz einer gediegenen musikalischen Kultur. Er vermochte eine Partitur zu lesen und daraufhin zu beurteilen. Allerdings blieb sein musikalischer Geschmack der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verhaftet und Mozart blieb immer sein Abgott. (Romain Rolland) Was die Vertonung von Liedern anbelangte, so ließ er sich maßgeblich durch Zelter aber auch durch Reichardt beeinflussen. Die Lieder des Letzteren schätzte er übrigens besonders. („Reichardt hat mir wohlgetan“) Sie entsprachen seinen Vorstellungen, wie Gedichte zu vertonen seien. Die Musik hatte der Dichtung zu „dienen“, hatte sie nicht zu kommentieren und durch etwas Eigenständiges zu einer höheren Stufe zu führen, da ihm das nicht nötig (und vielleicht auch nicht möglich) schien. Dichtung war für ihn schon „Musik an sich“. Der Ausdruck, die „Musik beginne da, wo der Verstand nicht mehr ausreiche“, wie Bettina von Arnim in einem Brief an Goethe schrieb, prägte erst die Romantiker. Goethe verschloss sich gegen diese irrationale Ebene, wie man es aus einem Brief Goethes an Klopstock 1808 ersehen kann, in dem er schreibt „einzig das Wort, im Gegensatz zur Musik“, habe „mit der Vernunft etwas zu schaffen“. Carl Loewe: Carl Loewe, geb.1796 und somit ein Jahr älter als Schubert, war auch Zeitgenosse der Romantiker, wie beispielsweise Robert Schumann, den er um 13 Jahre überlebte. Er wird ja gerne ausschließlich mit seinen Balladen identifiziert und deshalb oft als reiner Balladenkomponist bezeichnet. Dass er neben den Balladen außerdem auch noch zahlreiche Lieder, Oratorien, Opern und Kammermusik geschrieben hat ist den meisten Hörern heutzutage in der Regel nicht bekannt. So füllen seine Lieder, zusammen mit den Balladen und Legenden, 17 Bände in der Dicke der sieben Schubert-Bände. Dass zwei Bände allein mit Goethe-Vertonungen gefüllt sind, macht ihn zu einem der wichtigen Goethe-Komponisten, was sich aber merkwürdigerweise noch nicht im Konzertrepertoire niedergeschlagen hat. Dies ist ein großes Anliegen von mir. Dass Sie heute hauptsächlich wieder nur Balladen zu hören bekommen, hängt damit zusammen dass wir uns nicht zu sehr spezialisieren wollen um ein möglichst breites Spektrum anzubieten. Anhand des ersten Liedes werden Sie aber sofort auch Loewes lyrische Qualitäten erkennen. Loewe strebte, genau wie Schubert, danach, Goethes Gunst zu erlangen. Einmal war er sogar bei ihm in Weimar, um ihm seinen Erlkönig vorzuspielen. Leider wurde nicht daraus, da Goethe kein Klavier im Hause hatte, so dass sie nur einen Nachmittag miteinander im Gespräch verbrachten und Loewe ungehört wieder abreisen musste. Zu einem weiteren Treffen kam es dann nicht mehr. Zur 3. Gruppe: Zu Beginn der folgenden Gruppe hören Sie das zu dem vorhin gehörten Schubertischen korrespondierende „Wanderers Nachtlied“, mit dem Textanfang „Über allen Gipfeln ist Ruh“. Dieses Gedicht entstand 1780, vier Jahre nach dem ersten und wurde von Goethe ursprünglich in die Holzwand einer Jagdhütte eingeritzt, in der er auf seiner zweiten Harzreise des Abends eingekehrt war. Loewe vertonte übrigens, wie Schubert, beide Lieder, wobei sie bei ihm eher zyklisch zu sehen sind und eigentlich hintereinander erklingen sollten, wie Sie es anhand des offenen Endes erahnen werden. Die beiden darauffolgenden Balladen, dürften Ihnen ebenfalls eher in der Vertonung Schuberts bekannt sein, wobei der Erlkönig von Loewe unter Kennern eigentlich schon seit Langem anerkanntermaßen ebenbürtig neben dem von Schubert steht. Der Fischer ist auf jeden Fall eine Ausgrabung und stellt, meiner Meinung nach, eine sehr reizvolle Alternative dar. Der Erlkönig und Der Fischer sind zwei Balladen, die gemein haben, dass in ihnen die Natur als etwas Bedrohliches, Unheimliches hervortritt, und zwar durch den Zusammenklang zwischen der Natur und Regungen, die in der Tiefe der menschlichen Seele verborgen sind. Inspiration für den Fischer war vielleicht der Selbstmord einer jungen Adeligen, die sich in der Nähe von Goethes Haus in der Ilm ertränkt hatte. (Dazu noch mit einer Ausgabe des Werther in der Tasche!) Es herrschte hierauf eine längere Zeit ein großes Unbehagen in der Nähe des Unglücksortes, wie man aus dem Brief Goethes an Charlotte von Stein vom 19. Januar 1778, zwei Tage nach dem Selbstmord heraushören kann:
Dem Erlkönig liegt eine, von Herder übersetzte, dänische Ballade zugrunde („Erlkönigs Tochter“). Das dänische Wort „Ellerkonig“ hat allerdings die Bedeutung „Elfenkönig“. Dieser „Übersetzungsfehler“ hat also zu der Naturszenerie in Goethes Ballade geführt. |
3. Gruppe:
Carl Loewe:
|
Wolf/Schoeck: Die beiden letzten Komponisten verbindet einmal, dass sie beide keine Zeitgenossen Goethes waren, ihn also schon als „den Klassiker“ der deutschen Literatur vertonten, und dass Goethe-Lieder in ihren Liedschaffen einen beträchtlichen Platz einnehmen. Während Wolf vorwiegend Texte aus Wilhelm Meister und dem West-östlichen Divan vertonte, versuchte sich Schoeck auch an Gedichtsammlungen, die bis dato noch nicht ausführlich komponiert waren. (Venezianische Epigramme, Bücher des Unmuts, etc.) In der Wolf-Gruppe hören Sie gleich drei Lieder, anhand derer man deutlich die verschiedenen Seiten in Wolfs Stil vorführen kann. In „Anakreons Grab“ hören wir den Lyriker Wolf, der mit seiner reichen Harmonik Goethes Kniefall vor seinem berühmten Vorbild Anakreon perfekt untermalt und eine ganz zauberische Atmosphäre schafft. Im Rattenfänger, mit seiner straffen Rhytmik, meint man förmlich die „Genialität“ von Goethe und Wolf sich verschmelzen zu sehen. Wie Sie vielleicht wissen, war Wolf ja manisch-depressiv und komponierte nur während seiner manischen Phasen. Dieses "Manische" in seiner Musik spiegelt sich, wie auch im Feuerreiter, meiner Meinung nach ziemlich deutlich in diesem herrlichen Lied. Zuletzt hören Sie Wolfs wie auch Goethes komische Seite, die heute ein wenig zu kurz gekommen ist. Köstlich, wie er den faulen Schäfer mit ein paar musikalischen Pinselstrichen charakterisiert, doch ich will Ihnen nicht zu viel verraten, falls Sie das Lied noch nicht kennen. Den Abend beschließen dann zunächst ein Zwiegesang aus dem West-östlichen Divan und zum Schluss eines der Venezianischen Epigramme von Otmar Schoeck. Schoeck studierte in Zürich und anschließend bei Max Reger in Leipzig Komposition und wirkte zeitlebens in der Schweiz als Komponist, Dirigent und Liedbegleiter. Er entwickelte seinen Stil parallel zur zweiten Wiener Schule um Schönberg und darf somit als ein Mittler zwischen Spätromantik und Moderne angesehen werden. Wie Sie hören werden ist sein Liedstil und sein umfassendes Liedwerk auch wieder eine Entdeckung wert. |
4. und 5. Gruppe:
Hugo Wolf:
Otmar Schoeck:
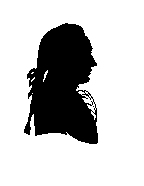
© Timothy Sharp Feb. 1999